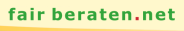Warum wir essen, was wir essen
Schon mit der Geburt haben wir gewisse Präferenzen. Später prägen sich Aromen hartnäckig in unser Geschmacksgedächtnis. Geschmack und die Aufgeschlossenheit für neue Geschmacksimpulse sind aber auch trainierbar.

Warum mögen wir, was wir essen? Ob Weißwurst, Schinkennudeln oder Schokopudding, die Lieblingsspeise aus Kindertagen besetzt einen festen Platz in unserem autobiografischen Gedächtnis. Weit über schlichte Sättigung hinaus vermittelt sie soziale Identität, Geborgenheit und Genuss, der uns auch später im Leben zuverlässig glücklich stimmt. Ähnlich tief kann sich das Gegenteil, Ablehnung oder gar Ekel vor einem Nahrungsmittel im Gedächtnis verankern.
Geschmacksvorlieben prägen unseren Charakter, so die populärpsychologische Annahme. Und tatsächlich gibt es Studien, die diesen Zusammenhang bekräftigen: So sollen Abenteurer ganz versessen auf Chilis sein oder Schokoladenliebhaber in sozialen Situationen eher liebenswürdig und hilfsbereit reagieren, Sweet Hearts eben.
Ein Geschmack von Geborgenheit
Insbesondere frisch verliebt entwickeln wir eine ungeahnte Offenheit in Geschmacksdingen. Plötzlich probiert der Vegetarier vom Steak und der Fleischesser schwärmt von Kichererbsen. Denn unter dem Einfluss des Bindungshormons Oxytocin werden wir vertrauensvoller und mutiger. Das Hormon erreicht uns schon im Mutterleib und später über die Muttermilch. Es hat vermutlich einen nicht geringen Anteil an unserer kulinarischen Erziehung. Bereits im Fruchtwasser schwimmend machen wir erste Geschmackserfahrungen. Ungefähr ab der 15. Lebenswoche beginnt der Fötus zu schlucken und je nach Zusammensetzung des Fruchtwassers passiert das mal häufiger, mal verhaltener. Süß ist die bevorzugte Geschmacksrichtung. Sie verheißt Energie in Form von Kohlenhydraten, die das Wachstum entscheidend beeinflussen. Durch das häufige Schlucken des süßen Fruchtwassers trainiert sich der Fötus regelrecht darauf, diese leicht zu verwertende Energieform aufzuspüren. Wann immer entsprechende Glucosemoleküle auf die Zunge treffen, wird ein körpereigenes Belohnungssystem aktiviert, Dopamin und Serotonin ausgeschüttet. Beide Hormone können zu einem glückseligen Lächeln und messbarer Entspannung beitragen.
Ähnlich beliebt ist die proteintypische, ebenfalls Energie verheißende Geschmacksrichtung umami – japanisch für würzig oder herzhaft – und in geringen Mengen auch salzig. Auch sie regen das Belohnungssystem an und lösen den Schluckreflex aus. Anders ist der Fall bei Säuren oder Bitterstoffen gelagert. Diese aktivieren zunächst ein Warnsystem, wir kennen es als Zungenstreck- oder Würgereflex. Säuren sind in unreifem Obst enthalten oder in vergorener und damit verdorbener Nahrung wie vergorener Milch. Dass wir sie nicht ohne weiteres trinken können, haben wir der Schutzfunktion des Geschmackssystems zu verdanken. Es ist besonders bei Bitterstoffen aktiv. Es gibt Menschen, die regelrecht hypersensibel auf Bitterstoffe reagieren. Jene werden von Pflanzen zur Abwehr von Fressfeinden oder zum Schutz vor extremen Umwelteinflüssen produziert, oftmals sind sie ausgesprochen giftig.
Dass wir später im Leben Bitterstoffe sehr gut vertragen, ihnen sogar verdauungsfördernde und immunisierende Wirkung zuschreiben, liegt nicht zuletzt an dem ausgereiften Entgiftungssystem von Leber und Nieren. Durch Kontakt mit bitteren Pflanzenstoffen kann es schon frühzeitig trainiert werden. Dabei nützt es keineswegs, dem Kleinkind gegen seinen Willen bittere Gemüsesäfte einzuflößen. Es reicht vollkommen, das Kind hin und wieder an einem Brokkoliröschen oder Artischockenherz knabbern zu lassen.
Geschmack als Schutz vor giftigen Stoffen
Um zu verstehen, woher die Ablehnung gegen Bitterstoffe und Säuren kommen kann, hilft ein Blick ins Tierreich. Obwohl junge Koalas Eukalyptusblätter lieben, meiden sie eine bestimmte Art von Blättern mit einem hohen Blausäuregehalt. Eine Studie der Universität Sydney machte spezielle Detox-Gene aus, die sich im Erbgut eines Koalas zum Schutz vor Giftstoffen häufen. Parallel fanden die Forscher Gene, die den Koalas helfen, die nahrhaftesten und gleichzeitig am wenigsten giftigen Blätter zu identifizieren. Und zwar einerseits durch Geschmacksrezeptoren und andererseits durch spezialisierte Geruchsrezeptoren. Geschmack ist nicht nur eine kulturelle Errungenschaft, er ist als existenzielle Notwendigkeit genetisch vorbestimmt. Geschmack lehrt uns, Dinge zu bevorzugen, die uns gut tun, und andere zu meiden, die uns Schaden zufügen.
Lebensmittelwüsten lassen Rezeptoren verkümmern
Im Laufe des Lebens verändert sich der Geschmack. Das liegt einesteils am Nahrungsangebot, aber auch an ganz normalen Abnutzungs- und Alterungserscheinungen, die sich durch Rauchen, extreme Säuren oder Hitze beschleunigen. Bitterrezeptoren verkümmern, wenn sie nicht aktiv genutzt werden. Diese sogenannten Loss-of-Function-Effekte werden durch Nahrungsmittel verstärkt, aus denen Bitterstoffe herausgezüchtet wurden. Einst besaßen Gurken bittere Enden, die vor dem Verzehr abgeschnitten werden mussten. Chicorée war so bitter, dass man ihn nur mit Sahne und Zucker genießen konnte. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Bitteres findet sich daher heute immer seltener im Nahrungsangebot. In den Regalen der Supermärkte dominieren kohlenhydratreiche Produkte von gesüßten Cerealien und Milchprodukten über Fertiggerichte und süßstoffgesüßte Lightprodukten bis zu gezuckerten Getränken. Demgegenüber steht eine vergleichsweise kleine Frischeabteilung mit Obst und Gemüse. Mancherorts fehlt diese sogar. Aus den USA stammt der Begriff Food-Desert, also Lebensmittelwüste. Er beschreibt Orte, in denen es ausschließlich verarbeitete Produkte zu kaufen gibt. Ihr hoher Gehalt an Geschmacks- und Aromastoffen ist geschmacklich weit entfernt vom natürlichen Angebot. Wer dem ausgesetzt ist, verliert die natürliche Fähigkeit zu schmecken. Der Geschmackssinn wird desensibilisiert und verlangt nach immer größeren Mengen Zucker, Salz, Fett und Geschmacksverstärkern. Allein in den USA leben 24 Millionen Menschen in den sogenannten Food-Deserts. Die staatliche Behörde für Landwirtschaft bezeichnet diese als „verarmte Gegenden, mit spärlichem Angebot an frischem Obst und Gemüse und starkem Überangebot von mit Zucker und Fett beladenen Lebensmitteln, die dafür bekannt sind, Auslöser für die landesweite Epidemie an Fettleibigkeit zu sein.“
Kinder früh auf Industrienahrung getrimmt
Sowohl Fruchtwasser als auch Muttermilch schmecken täglich anders. Geschmack und Aromen der Muttermilch hängen davon ab, was die Mutter gegessen hat. Säuglinge passen ihr Saugverhalten an die geschmackliche Zusammensetzung der Muttermilch an. Ist sie an heißen Sommertagen dünnflüssiger, trinken sie automatisch mehr.
Das Gegenteil ist der Fall bei industrieller Säuglingsnahrung. Flaschennahrung schmeckt immer gleich, sie wird ja unter standardisierten Bedingungen hergestellt. Wird ein Kind mit Säuglingsnahrung gefüttert, reagiert es später tendenziell empfindlicher auf neue Geschmäcker. Gleichzeitig bevorzugt es Lebensmittel mit Aromen, die es bereits aus der Säuglingsnahrung kennt, Vanillin zum Beispiel. Das vanilleähnliche Aroma aus dem Labor steckt in zahlreichen Industrieprodukten. Vom Keks über Frühstücksflocken bis hin zum Ketchup findet es breite Verwendung und bildet damit eine aromatische Brücke zu weiteren Produkten des jeweiligen Anbieters. Das Prinzip dahinter nennt sich Flavour-Flavour-Learning, also die Kopplung eines bekannten Geschmacks an einen neuen.
Anis und Knoblauch in der Muttermilch
Dass sich Aromen so hartnäckig im Geschmacksgedächtnis einprägen, liegt auch an der Durchlässigkeit der Plazenta. In einer Studie des Monell Chemical Senses Centers in Philadelphia bekamen Schwangere über Bonbons regelmäßig Anisaroma zugeführt. Die Forscher beobachteten direkt nach der Entbindung, wie Säuglinge auf das Anisaroma reagierten. Jene, die das Aroma bereits aus dem Bauch der Mutter kannten, wandten sich ihm zu, die anderen wandten sich tendenziell eher ab. Durch das Fruchtwasser bekannte Aromen, seien es Anis, Knoblauch, Zimt oder Karottenaromen werden später im Leben bevorzugt.
Schwangere, die im Verlauf einer weiteren Studie während der Schwangerschaft und Stillzeit Karottensaft tranken, erleichterten sich und ihren Kindern das spätere Zufüttern mit Karottenbrei. Ganz ähnlich dürfte der Fall bei Cola und Tiefkühlpizza liegen. Neben natürlichen, individuellen Präferenzen wird Geschmack buchstäblich mit der Muttermilch aufgesogen.
Je vielfältiger und ausgewogener sich eine werdende Mutter ernährt, desto aufgeschlossener wird das Kind in Geschmacksdingen. Es sei denn, es ist ein Superschmecker. Jene reagieren aufgrund einer genetisch veranlagten hohen Anzahl von Geschmacksknospen auf der Zunge ausgesprochen sensibel auf Geschmacksimpulse. Sie bevorzugen bekannte und vertraute Geschmäcker wie Pasta oder Pfannkuchen. In diesem gar nicht so seltenen Fall – immerhin ist davon jeder Vierte betroffen – bleibt nur entspannt abzuwarten, bis sich die enorme Sensibilität gelegt hat. In der Regel tritt das nach wiederholtem Kontakt mit ein und demselben Nahrungsmittel ein. Experten wie die UGB-Dozentin für Säuglings- und Kinderernährung Edith Gätjen schlagen vor, zehn bis dreizehnmal das Gleiche zu probieren. Irgendwann wird es dann einfach aus Gewohnheit gemocht und gegessen.
Frische Vielfalt trainiert den Geschmack
Dass Geschmack trainierbar ist wie Radfahren oder schwimmen, wissen die Franzosen übrigens seit langem. Das Feinschmeckervolk lehrt seinen Kindern zu Hause und in der Schule worauf es ankommt: auf frische und möglichst naturbelassene Produkte, die Balance zwischen den Geschmacksstoffen und Aromen, auf die verschiedenen Zubereitungsarten und nicht zuletzt auf das sinnliche Vergnügen, das Schmecken bereiten kann.
Bild © Olesia Bilkei/123RF.com
Stichworte: Geschmack, Geschmackssinn, Geschmacksvorlieben, Oxytocin, Säuren, Bitterstoffe, Geschmacksrezeptoren, Industrienahrung, Säuglinge, Muttermilch, Aromastoffe
 Dieser Beitrag ist erschienen in:
Dieser Beitrag ist erschienen in: UGBforum 6/2019
Dem Geschmack auf der Spur
Heft kaufen