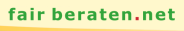Krebs und Psyche: Mut zum Überleben

Prof. Tschuschke, was genau ist eigentlich ein Psychoonkologe?
Onkologie ist die medizinische Fachrichtung, die sich mit Krebserkrankungen befasst. Die Psychoonkologie spezialisiert sich auf die Zusammenhänge zwischen psychischem Befinden, Krebsentstehung und Erkrankungsverlauf. Ein Psychoonkologe benötigt – zusätzlich zu seinem Grundberuf (Arzt, Psychologe, Schwester, Seelsorger, Sozialarbeiter etc.) – eine zusätzliche Qualifikation in Psychoonkologie. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat im letzten Jahr Leitlinien aufgestellt, nach denen psychoonkologische Fort- und Weiterbildungsinstitute anerkannt werden können. Ein Psychoonkologe hat also einen sozialwissenschaftlichen oder medizinischen Grundberuf, muss bereits mindestens ein Jahr mit an Krebs erkrankten Patienten gearbeitet haben und erhält nach erfolgreicher Fort- bzw. Weiterbildung an einem anerkannten Institut ein Zertifikat. Erst dann ist er berechtigt, seine psychoonkologischen Dienste anzubieten. Er kann dann entweder als psychoonkologischer Berater (psychosoziale Onkologie) tätig werden, dazu gehören dann onkologische Krankenschwestern, -pfleger, Sozialarbeiter, -pädagogen oder Seelsorger, nicht approbierte Psychologen. Oder er kann als Psychoonkologe im engeren Sinne therapeutisch tätig werden, wenn er als Arzt oder Psychologe über eine staatlich anerkannte Psychotherapieausbildung (Approbation) verfügt.
Was beinhaltet die Fortbildung für Psychoonkologen?
Die psychoonkologische Fort- bzw. Weiterbildung umfasst umfangreiches Wissen um Krebserkrankungen, onkologische Behandlungsvefahren, die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Kommunikation mit den Betroffenen und Angehörigen und spezifische psychologisch-psychotherapeutische Techniken, die sich bei Krebspatienten bewährt haben. Psychoonkologen müssen zudem Strategien der Krankheitsbewältigung, sogenanntes Coping, kennen und – nicht zu vergessen – ausgiebige Erfahrung mit dem Thema Tod und Sterben haben. Letzteres wird über ausbildungsbegleitende, umfangreiche Selbsterfahrung vertieft.
Die meisten Menschen reagieren auf die Diagnose Krebs mit Angst und Verzweiflung. Ist eine psychische Betreuung der Betroffenen vorgesehen?
In Deutschland ist eine fachkompetente Betreuung leider noch die Ausnahme, im Gegensatz beispielsweise zu den USA oder Kanada. Das heißt, dass Ärzte bzw. Onkologen in den meisten Fällen noch nichts über die psychische Belastung ihrer Patienten wissen und entsprechend auch nicht helfen können. Und das, obwohl zwischen 15 und 35 Prozent aller Patienten allein aufgrund der Diagnose ein Trauma erleiden. Dieser Schock muss speziell behandelt werden, sonst ergeben sich schwerste psychophysische Belastungen, beispielsweise Blockaden im zentralen Hirnbereichen. Sie können dazu führen, dass der Betroffene keine Kräfte frei hat, um die Erkrankung und die Behandlung zu bewältigen. Bleibt das aus, verschlechtern sich zwangsläufig die Prognosen. Allerdings findet in den letzten Jahren eine verstärkte Integration von psychosozialer Onkologie und Psychoonkologie in die Tumorzentren und -kliniken statt, die entsprechend fort- und weitergebildetes Personal einstellen müssen, um eine Zertifizierung als Zentrum zu erwerben bzw. aufrechtzuerhalten.
Viele fragen sich nach der Krebsdiagnose: Warum gerade ich? Hab ich in meinem Leben etwas falsch gemacht? Gibt es so etwas wie eine Krebspersönlichkeit?
Wir Menschen suchen stets nach Erklärungen. Finden wir für uns plausible Antworten, ohne Rücksicht auf deren Wahrheitsgehalt, sind wir bereits beruhigter. Rückblickend lassen sich immer scheinbar plausible Erklärungen für die Erkrankung finden. Aber diese sind geprägt durch das Wissen um die Krankheit. Das heißt, sie sind „durch die Brille der Erkrankung gesehen“ und insofern wissenschaftlich nicht gültig. Um den Beitrag psychischer und sozialer Faktoren am Ausbruch der Krankheit abschätzen zu können, müsste man Hundertausende von Menschen jahrzehntelang wöchentlich wissenschaftlich begleiten. Nur so ließe sich der Beitrag psychischer Faktoren am Krankheitsausbruch ein für alle Male klären. Gleichzeitig sind natürlich auch die genetischen, die ernährungs- und bewegungsbedingten Gründe, Fehlverhalten wie Rauchen und Drogenmissbrauch, Umweltgifte, Strahlen und Dämpfe an Arbeitsplätzen etc. zu berücksichtigen. Die Frage nach einer Krebspersönlichkeit wird sich wegen des beschriebenen immensen Aufwands wohl nie klären lassen. Die Krebspersönlickeit, die sich in Depression, Niedergeschlagenheit oder Antriebslosigkeit äußert, ist häufig eher als eine Reaktion auf die Erkrankung aufzufassen denn als Ursache.
Andererseits verdichtet sich in den letzten Jahren die Forschungserkenntnis, dass negativer Dauerstress – sei es psychisch, sei es durch Schadstoffe – das Krebsrisiko erhöht. Und man weiß inzwischen auch, dass mehr als zwei Drittel aller Krebserkrankungen auf unsere falsche moderne Lebensweise zurückzuführen sind: das schon angesprochenene Risiko- und Fehlverhalten sowie Schädigungen durch Umweltgifte. Das heißt, hinter vielen der falschen Verhaltensweisen bzw. stressbedingten Anspannungen stecken psychische Faktoren, etwa indem ich als Betroffener mit meinen Berufs-, Alltags-, Beziehungsbelastungen nicht richtig umgehen kann, so dass eben Fehlverhalten oder Dauerstress – und unangemessene Reaktionen dagegen – resultieren. Das kann dann mein Krebsrisiko erhöhen.
Zusammenhänge zwischen Psyche und Immunsystem sind mittlerweile ja nachgewiesen. Muss da die Psyche nicht auch in der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen?
Genau. Wir haben alle Glieder der Kette wissenschaftlich geklärt: Das Immunsystem wird durch psychische Prozesse wie Stress oder Freude negativ oder positiv beeinflusst. Es wirkt auch direkt auf Tumoren und verhindert den Ausbruch von Krebs. Wenn es dagegen versagt, ist Krebs die Folge. Also müssten sich auch bestimmte psychische Zustände positiv oder negativ auf die Erkrankungswahrscheinlichkeit auswirken. Solche Untersuchungen aber fehlen weitgehend noch; genau diese Studien benötigten wir im Moment. Danach käme man nicht mehr darum herum, psychoonkologische Kompetenzen an Reha-Kliniken wie auch im niedergelassenen Bereich routinemäßig einzuführen und die Rolle der psychosozialen Onkologie besser zu honorieren.
Mit der Diagnose Krebs gehen Betroffene unterschiedlich um. Manche wollen alles über Therapien wissen, andere verdrängen die Erkrankung. Was ist für den Krankheitsverlauf am besten?
Alle besseren wissenschaftlichen Studien weisen eindeutig in dieselbe Richtung: Ein aktives Bewältigungsverhalten – wie immer man das nennen will: kämpferische Einstellung, Lebenswille, aktive Mitarbeit an erforderlichen Therapiemaßnahmen, intensiveres Leben im Jetzt, gesünderes Leben usw. – scheint mit besseren Überlebenschancen verknüpft. Resignation und Apathie sind genauso ungünstig wie Ablenkung, ohne die Krankheit wirklich bewältigt oder sich damit auseinandergesetzt zu haben. Dazu zählt auch die aktive Überbeschäftigung, die eigentlich Vermeidungscharakter hat.
Braucht jeder Krebspatient psychologische Hilfe? Was kann eine psychoonkologische Behandlung leisten?
Nicht jeder Patient benötigt diese Hilfe. Entscheidend ist, ob ausreichend stabile eigene Krisen- und Bewältigungsressourcen und auch gute soziale Unterstützung in der Familie oder im Freundeskreis vorhanden sind oder nicht. Im Prinzip hilft aber allen eine professionelle Begleitung bereits von der Diagnose und frühen Behandlungsphasen an. Denn zur Aufgabe des Psychoonkologen gehört auch, kommunikative Barrieren und Sprachlosigkeit zwischen Patient und Umfeld zu überwinden, speziell auch zu den Ärzten. Oft kommt es zu Fehlinformationen oder Missverständnissen zwischen dem geschockten Patienten und Ärzten, die nicht die notwendigen kommunikativen Fähigkeiten mitbringen. Psychoonkologen sind auch dazu da, den Betroffenen dabei zu helfen, sich mehr mit ihrer Erkrankung zu beschäftigen und beispielsweise Wissen darüber zu erwerben. Damit bekommen sie ein Gefühl von mehr Kontrolle, was Angst und Verzweiflung abbaut und insgesamt zu mehr Lebensqualität verhilft.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld für den Umgang mit der Erkrankung? Sollten Angehörige und enge Freunde ebenfalls in die Therapie einbezogen werden?
Im Prinzip ja! Hier ergibt sich zu häufig – zusätzlich zu den übrigen Problemen – ein sozialer Tod. Zu oft ziehen sich Freunde, Familienangehörige oder Kollegen zurück, durchaus auch aufgrund von Unkenntnis oder Angst, nicht unbedingt aus Gleichgültigkeit. So eine Isolierung kann sich schrecklich auf den Betroffenen auswirken. In aller Regel handelt es sich um beiderseitige Sprachlosigkeit. Der Patient fragt sich: „Was kann ich meiner Familie zumuten?“; der Freund ist unsicher: „Was kann ich dem Kranken zumuten“. Doch das Motto sollte lauten, besser gemeinsam als jeder einsam.
Rund die Hälfte aller Krebspatienten kann heute geheilt werden. Ist die Psyche dieser Patienten im Nachhinein noch belastet?
Ein Großteil der ehemaligen Patienten bleibt dauerhaft belastet. Einmal von Krebs betroffen, führt dies zu einer chronischen Erkrankung. Man wird nie wieder in einen jungfräulichen Zustand geraten. Alle ehemals Erkrankten sind mit der Tatsache der Endlichkeit, des Sterben-Müssens konfrontiert. Ab dann ist diese Tatsache nicht mehr zu leugnen. Wer es dennoch tut, gerät unweigerlich in Probleme. Das zeigen auch alle Studien. Man muss sein Leben umstellen. Es ist auch eine Chance zu bewussterem, intensiverem Leben, wie uns viele Überlebende spontan in Interviews mitteilen. Es geht darum, eine in unserer Gesellschaft durch Verdrängung und Vermeidung fehlende Kultur des Umgangs mit einer prinzipiell in jedem Fall endlichen, begrenzten Lebenszeit zu fördern, es geht um die Entgiftung der Themen Tod und Sterben. Eine normale Angst vor dem Tod oder dem Sterben muss resultieren. Denn eine neurotische Verdrängung entspannt doch nur oberflächlich, weil unbewusst Panik herrscht und zu unglaublichen Fluchtreaktionen, also Fehlverhaltensweisen veranlasst. Krebsüberlebende berichten immer wieder von einer großen Entspanntheit und dem gewonnenen Blick auf das Wesentliche in ihrem Leben. Unwichtiges kann nun besser von Wichtigem getrennt werden. Manchmal berichten Betroffene von einem ab dann wesentlich besseren, intensiveren Leben. Als ob es tatsächlich eines solchen „Schusses vor den Bug“ bräuchte, um zu erkennen, wie unaufmerksam wir häufig im Alltag mit unserem Leben und unserem Körper umgehen. Eine Erkenntnis, die an und für sich jeder von uns jederzeit erlangen könnte, ohne solch eine Not erlebt haben zu müssen. Für ehemals Erkrankte, die chronisch an Stress oder Schlafstörungen leiden und deren Lebensqualität aufgrund von Angst und Depression beeinträchtigt ist, empfiehlt sich unbedingt eine Therapie bei einem fachkompetenten Psychoonkologen oder psychoonkologisch ausgebildeten Psychotherapeuten.
Wohin können sich Betroffene und Angehörige auf der Suche nach psychologischer Hilfe wenden?
Betroffene sollten sich an die größeren Tumorzentren wenden, die haben am ehesten Adressen von Psychoonkologen. Auch die Deutsche Krebsgesellschaft oder der Krebsinformationsdienst sind geeignete Ansprechpartner. Sie können sich auch an uns wenden (www.psyonko-koeln.de)
. Wir haben Adressen von bei uns ausgebildeten Psychoonkologen, auch im niedergelassenen Bereich. Falls man keine professionelle Hilfe bekommt, sind Selbsthilfegruppen vermutlich besser als gar nichts, das gilt für alle Erkrankungen.
Wie macht man sich Ihrer Ansicht nach stark gegen Krebs? Was würden Sie empfehlen?
Besser, intensiver und gesünder leben. Das heißt im Wesentlichen: ausreichend körperliche Bewegung, negativen Stress reduzieren, Fehlverhalten abbauen, gesunde Ernährung, Zeiten für gezieltes Entspannen und Erleben einplanen. Bewusster im Hier und Jetzt leben, anstatt ständig nur als Hamster im Laufrad unterwegs zu sein. Krebs ist in den meisten Fällen ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, wir wissen in den seltensten Fällen, warum jemand an Krebs erkrankt und warum gerade jetzt. Selbst die Menschen, die am gesündesten leben, erkranken manchmal an dieser Krankheit und Kettenraucher können zuweilen ein hohes Alter erreichen, ohne zu erkranken, obwohl die Lunge vollständig verteert ist. Das ist das verbleibende Geheimnis von Erkrankung und Gesundheit. Allerdings kann man an den „Rädern drehen“, die man selbst beeinflussen kann, und das sind – statistisch gesehen – unsere Risiken aufgrund der modernen Fehlverhaltensweisen in ihren vielfältigen Facetten.
Prof. Dr. Tschuschke, herzlichen Dank für das Interview.Onlineversion von: Tschuschke V. Krebs und Psyche: Mut zum Überleben. UGB-Forum spezial: Aktiv gegen Krebs. S 21-24, 2011