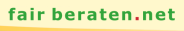Ernährungserziehung: Kinder brauchen Vorbilder
Aufbauend auf den genetischen und physiologischen Grundlagen bestimmt eine liebevolle Ernährungserziehung das Essverhalten von Kindern. Die Vorbildfunktion der Eltern gehört ebenso dazu wie natürliche Entwicklungsschritte zu berücksichtigen.

Bereits ab der zehnten Schwangerschaftswoche bilden sich beim Ungeborenen erste Geschmacksknospen auf der Zunge und in der Mundschleimhaut. Ab der 13. Woche reifen die Geschmacksnerven, so dass der Fötus nun beginnt, Geschmackseindrücke zu verarbeiten. Das Fruchtwasser schmeckt nach der von der Mutter aufgenommenen Nahrung. So ist es zu erklären, dass Geschmacksvorlieben bereits im Mutterleib geprägt werden – quasi angeboren sind, wenn auch nicht im genetischen Code verankert.
Die Geschmacksprägung beginnt also bereits im Mutterleib und ist damit auch die Grundlage der Gesundheitsvorsorge. Dieser Prozess geht während der Stillzeit weiter. Denn auch die Muttermilch nimmt den Geschmack des von der Stillenden verzehrten Essens an. Gestillte Kinder haben durch die Variationen des Muttermilchgeschmacks erheblich bessere Startmöglichkeiten für das Heranführen an den Familientisch als Flaschenkinder, deren Milch jeden Tag identisch schmeckt.
Geschmack entwickelt sich lebenslang
Ein neugeborenes Kind schmeckt bereits die Geschmacksrichtungen süß, sauer und bitter, wobei es süß präferiert, sauer und bitter dagegen ablehnt. Mit vier Monaten kommen salzig und umami hinzu. Die rein organische Entwicklung der Geschmacksorgane ist mit etwa drei Jahren abgeschlossen, die Geschmacksentwicklung, das Prägen des Geschmacksgedächtnisses geht allerdings lebenslang weiter. Alle Geschmackserlebnisse werden schnell und nachhaltig gelernt, auch die negativen. Wie bei allen Lernprozessen spielen dabei die Begleitumstände des Lernens eine große Rolle.
Ebenso gibt es genetisch angeborene Geschmackspräferenzen. Sie haben sich im Laufe der Entwicklung des Menschen ausgebildet und schützen den Körper vor Gefahren. Auf der anderen Seite sind sie dafür zuständig, dass der Körper mit den notwendigen Stoffen ernährt wird. So sorgt die Präferenz für süß für das Überleben, da reife, süße Früchte reich an dem Energielieferanten Zucker sind sowie Mineralstoffe und Vitamine liefern. Bittere Geschmacksrichtungen sind hingegen eher ein Hinweis auf unreif, verdorben und potenziell giftig. Die Präferenz für salzig“ ist ein Hinweis darauf, dass der Körper für seinen Wasserhaushalt Natrium dringend benötigt. Auch wenn Salz in früheren Zeiten schwierig zu beschaffen war, sorgte das körperliche Bedürfnis nach salzigem Geschmack dafür, dass unsere Vorfahren nach Salz suchten, um überleben zu können. Für das Überleben war auch der Konsum von Fett wichtig: zum einen als wichtiger Energieträger, aber auch als Geschmacksträger, der andere Geschmacksrichtungen verstärkt.
Die Kleinsten mögen Süßes und Fettiges
Uns ist also zunächst genetisch gegeben, Süßes und Fettiges auszuwählen, Bitteres jedoch abzulehnen – Muttermilch erfüllt diese Anforderungen perfekt. In den ersten Lebensmonaten erfährt das Kind, dass es mit der süßen, fetten Milch gut gedeiht und ist dann später, wenn es darum geht, Beikost zu essen und am Familientisch teilzunehmen, immer wieder auf der Suche nach Süßem und Fettigem. Diese Nahrungsauswahl ermöglicht es den Kindern, sich mit ihrem großen Energiebedarf bei gleichzeitig relativ kleinem Magen mit genügend Energie zu versorgen. Der kritische Blick auf das Gemüse ist vor diesem Hintergrund leicht zu verstehen. Er ist kein Trotz gegen den Elternwillen, sondern pure Überlebensstrategie: Gemüse mit geringem Energiegehalt, das noch nicht einmal süß ist, füllt zwar den Magen, macht jedoch nicht genügend satt. So erklärt sich auch, dass zu einer Gemüsemahlzeit im Säuglingsalter ein ganzer Esslöffel Rapsöl gehört und auch die Empfehlung, gegartes Gemüse für Kinder immer mit komplexen Kohlenhydraten, Fleisch, Fisch oder Ei zu kombinieren. Gemüse als Frischkost-Fingerfood wird hingegen sehr gerne gegessen, hat aber in der Hauptsache einen spielerischen Effekt – es kracht so schön – und löscht den Durst. Bei der warmen Mittagsmahlzeit hingegen haben die Kinder das Bedürfnis, sich zu sättigen, und da reicht das pure gegarte Gemüse einfach nicht aus.
Emotionaler und kognitiver Einfluss
Neben den genetischen und physiologischen Faktoren spielt – spätestens am Familientisch – das ganz normale Lernen eine Rolle. Einer der wichtigsten Unterstützungsfaktoren beim Lernen ist die emotionale Begleitung, ob positiv oder negativ. Für diese emotionale Begleitung sind wir Erwachsenen essenziell verantwortlich. Damit Kinder beim Essen positiv lernen können, braucht es freundliche Erwachsene, die zum Probieren animieren, eine Ablehnung aber auch akzeptieren. Kein Kind sollte gezwungen werden, etwas probieren zu müssen. Beim Kennenlernen eines neuen Lebensmittels sind alle Sinne beteiligt, das Sehen, Fühlen, Riechen, Hören – und schließlich auch das Schmecken.
Multiple Kontakte – auch solche außerhalb des Geschmackskontakts – sind die entscheidende Voraussetzung für ein späteres erneutes Probieren und eventuell sogar Mögen. Daraus wird klar, dass neue Lebensmittel auf jeden Fall mehrmals und regelmäßig wiederholt angeboten werden müssen, bis ein Kind sich dazu entschließt, sie in den Mund zu nehmen, sie zu probieren und dann später zu entscheiden, ob es sie mag oder nicht. Im Schnitt braucht es für diese Entscheidung 10 bis 15 Kontakte mit ein und demselben Lebensmittel. Allerdings ist der erste Kontakt der wichtigste Schritt. Wenn dieser freiwillig und ohne negativen Beigeschmack geschieht, bekommt das Kind Mut, es noch einmal zu probieren – vielleicht mit einem anderen Sinn.
UGB-Seminar: Jugendliche motivieren

Gesundheit bei Heranwachsenden zu fördern, braucht als Basis Einsicht in ihre Lebenswelt und Verständnis für ihre Entwicklungsschritte. Die Autorin Edith Gätjen, selbst Mutter von vier Kindern, zeigt im Seminar „Jugendliche motivieren“ anhand des Themas Ernährung einen systemischen Ansatz auf, was Kinder und Jugendliche beeinflusst und formt und wer sie wie fördern kann. Das Seminar richtet sich gleichermaßen an interessierte Eltern, Lehr- und Ernährungsfachkräfte sowie andere Personen, die mit Heranwachsenden arbeiten.
Jedes Kind hat ein grundlegendes Bedürfnis, hier wie in allen anderen Situationen des Alltags, respektvoll angenommen, verstärkt und bekräftigt zu werden. So ist es wichtig, allein den Versuch zu loben, mit dem neuen Lebensmittel Kontakt aufzunehmen, und wenn es nur darum geht, dass eine einzige Erbse in den Mund gesteckt wurde. Ist der Erstkontakt hingegen mit einem negativen Erlebnis verbunden wie „Du musst das jetzt essen!“, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass genau dieses Lebensmittel erst einmal negativ belegt wird. Es kann so auch passieren, dass die allgemeine Neugier gedämpft wird und das Kind sich gegenüber neuen Lebensmitteln verschließt. Die Aussage „Bevor Du das nicht einmal probiert hast, kannst Du nicht sagen, dass es Dir nicht schmeckt“ gilt eben nicht. Vielmehr sollte es lauten: „Ich gebe Dir Zeit, das neue Lebensmittel mit allen Sinnen kennen zu lernen und biete es immer wieder an; Du entscheidest, wann und ob Du es in den Mund nehmen möchtest.“ Daraus resultiert die Grundregel für den Familientisch: „Wir Eltern entscheiden, wann, was und wie gegessen wird, die Kinder entscheiden, ob und wie viel sie davon essen.“
Zum Nachahmen gehört das Vorleben
Besonders hilfreich ist es, wenn Eltern klar und transparent ihren Kindern das Essverhalten vorleben, das sie von ihnen wünschen – und das 24 Stunden am Tag. Und an genau dieser Stelle scheitern viele Familien. Zusätzlich gestalten freundliche Erwachsene eine angenehme Atmosphäre. Sie sorgen dafür, dass bei der Mahlzeit weder Telefon noch Fernsehen, Streit, schlechte Laune und unangenehme Themen die Konzentration auf das Essen und die positive Grundstimmung stören.
Bis zu einem Alter von etwa 1,5 Jahren essen die Kinder alles das, was ihnen vorgelegt wird. Sie fühlen sich sicher, dass sie keinen Schaden erleiden – am allersichersten ist das natürlich dann, wenn sie sogar vom Elternteller mitessen dürfen. Bis zum vierten Lebensjahr entwickeln Kinder mehr und mehr eigenen Willen. Zeitgleich zu ihrer allgemeinen Autonomiebestrebung wollen sie auch eine individuelle Essensauswahl treffen und selbst Lebensmittel für sich als sichere und weniger sichere Lebensmittel einteilen. Hier geht es für sie einzig und alleine um Vorsicht, nicht um Verzicht. Wir helfen ihnen, wenn wir ihnen in dieser Zeit die Gerichte so übersichtlich wie möglich anbieten.Bis zum achten Lebensjahr kommt das soziale Lernen als zusätzlicher Sicherheitsgarant dazu. Die Kinder sind nun in der Lage, Transferleistungen herzuleiten. Sie können verschiedene Vorerfahrungen zusammenführen und auf dieser Grundlage Mut für neue Entscheidungen schöpfen. Später verabschieden sie sich von ihren alten Gewohnheiten. Außenwirkungen, beispielsweise die Welt der Freunde, bestimmen den Essalltag – allerdings auf der Basis des eigenen Geschmacksgedächtnisses.
Feste Regeln sind hilfreich
Bei jeder Form der Erziehung sind Regeln hilfreich und erleichtern den Umgang miteinander, auch bei der Ernährungserziehung. Hier unterstützen sie das Funktionieren einer Essensgemeinschaft. Zu diesen Regeln gehören regelmäßige Essenszeiten. Das impliziert, dass jede Mahlzeit einen Beginn und ein Ende hat, damit sich zu den Mahlzeiten der Hunger auch wirklich einstellen kann, denn Hunger ist der beste Koch.
Die Ausbildung des Ernährungsverhaltens lässt sich grob in sechs Phasen einteilen. Steht anfangs die Entwicklung der Motorik im Vordergrund, ist es später das Spannungsfeld zwischen Bindung, Ablösung und Autonomie. Die Phasen beziehen sich zum einen darauf, was und in welcher Form ein Kind an Nahrung zu sich nimmt, aber auch welches die Motive dafür sind.
Bei der ersten Phase im Mutterleib handelt es sich noch um eine passive, kontinuierliche Ernährung, die beiden darauf folgenden Phasen, die Milch- und Beikostzeit, sind geprägt von Hunger, Durst, Saugbedürfnis, Körperkontakt und immer mehr auch Neugierde. Zwischen dem 11. und 18. Lebensmonat, der vierten Phase, kommt zu diesen Grundbedürfnissen auch noch das Imitieren, Spaß und Spiel hinzu. Ab etwa 1,5 Jahren bis zum 8.-10. Lebensjahr ist das Essverhalten in der fünften Phase zusätzlich geprägt von der Selbstbestimmung, dem Gemeinschaftserleben, Futterneid und Trotz.
In der sechsten Phase steht dann die Abgrenzung vom elterlich vorgegebenen Verhalten im Vordergrund, was dazu führt, dass zum einen die Peergruppe, zum anderendas Image, sportliche Leistung, Ökologie, Politik und Soziales wichtiger werden.
Gegessen wird also gemeinsam und es gibt für alle das gleiche Essen. So steht niemand im Mittelpunkt, denn derjenige, der ein anderes Essen bekommt, gehört nicht zur Gemeinschaft. Jeder darf sich ein Essen wünschen, darf aber auch höflich und freundlich bestimmte Lebensmittel ablehnen, ohne Druck zu spüren. So darf sich jeder so viel nehmen, wie er essen kann – dies erfordert jahrelange Übung. Das gilt natürlich nur, wenn das Angebot am Tisch nach vollwertigen Regeln zusammengestellt worden ist. Zudem einigt man sich auf bestimmte Tischmanieren, um die sich alle entsprechend ihrer Fähigkeiten bemühen sollten.
Das Erlernen des Ernährungsverhaltens beginnt im Mutterleib, wird fortgeführt in der Stillzeit, der Beikost und dann in einer gesundheitsförderlichen Ernährungserziehung. In allen Bereichen sind die Eltern und die übrigen Erziehungberechtigten hauptverantwortlich. Gerade die ersten drei Jahre, von der 13. Schwangerschaftswoche an, prägen hauptsächlich das Ernährungsverhalten. Zwar kann man später zeitweilig über das Ernährungsverhalten seiner Kinder verzweifeln, das sich durch ihre Autonomiebestrebungen anders gestaltet als gewünscht. Doch wenn wir früh genug die richtige Saat gesät haben, können wir sicher sein, dass wir später reichlich ernten können.
Quelle: UGB-Forum 2/13, S. 89-92
Foto: BlueOrange Studio/Fotolia.de