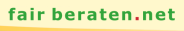Nanomaterialien: Was machen Zwerge im Essen?
Weitgehend unbemerkt fügen Hersteller Lebensmitteln und Küchengeräten immer häufiger Nanomaterialien zu. Dabei sind die Risiken dieser Winzlinge bislang nicht hinreichend geklärt. Die Gesetzgebung hinkt hinterher.

Der Begriff Nano kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg: Nanopartikel sind also besonders kleine Teilchen, ein Nanometer misst nur den milliardsten Teil eines Meters. Im Unterschied zu größeren Teilchen der gleichen Substanz haben sie besondere Eigenschaften, was sie für viele Anwendungen interessant macht, aber auch neue Risiken birgt. Durch ihre sehr stark vergrößerte Oberfläche sind sie im Vergleich zu größeren Partikeln unter anderem chemisch reaktiver und biologisch aktiver. Das kann auch zu einer höheren Toxizität der Nanopartikel beitragen.
Nanomaterialien werden im Lebensmittel-, Futtermittel- und Landwirtschaftssektor derzeit hauptsächlich in Form von Nanokapseln, Nanosilber und Nanotitandioxid eingesetzt. Sie dienen als Verarbeitungshilfen und Lebensmittelzusatzstoffe wie Titandioxid als Weißpigment, Siliziumdioxid als Rieselhilfe oder Carotinoide als Farbstoffe. In Nahrungsergänzungen können nanoverkapselte Vitamine oder andere angeblich gesundheitsfördernde Zusatzstoffe zugesetzt werden. Lebensmittelverpackungen können Nanomaterialien enthalten, um den Inhalt länger frisch zu halten, etwa über eine antibakterielle Wirkung oder eine Barrierewirkung gegen Gase und Feuchtigkeit.
Wirkungen meist noch unbekannt
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erwartet, dass „nanotechnologische Erzeugnisse in der Zukunft einen erheblichen Einfluss auf den Lebens- und Futtermittelsektor haben könnten“. Gleichzeitig gibt es nach wie vor große Wissenslücken, was die Sicherheit der Nanomaterialien betrifft, insbesondere wenn sie über Lebensmittel aufgenommen werden, und über ihr Verhalten in der Umwelt. Studien zeigen Risiken, denen kaum ein Nutzen für Verbraucher gegenüber steht. Synthetische Nanomaterialien wurden nach oraler Aufnahme in Organen wie Herz, Leber, Milz, Lunge, Niere, Gehirn und dem Knochenmark nachgewiesen. Auch ein Übertritt über die Plazenta in den Fötus ist möglich. Zudem gibt es Hinweise, dass die winzigen Teilchen die Blut-Hirn-Schranke überwinden können.
Nanomaterialien können in Zellen eindringen. Durch die Aufnahme von nicht abbaubaren Nanopartikeln kann es über eine akute Toxizität hinaus möglicherweise zu gesundheitlichen Langzeitschäden kommen. Verschiedene Studien bringen Entzündungsreaktionen im Magen-Darm-Trakt mit dem Einwirken von Siliziumdioxid- und Titandioxid-Nanopartikeln in Verbindung. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und das Umweltbundesamt sehen deutliche Hinweise darauf, dass einige Nanomaterialien ein krebserregendes oder stärker krebserregendes Potenzial im Unterschied zu größeren Partikeln aus demselben Material besitzen.
Zunehmender Einsatz
Der Einsatz von Nanomaterialien im Umfeld Lebensmittel hat innerhalb des zurückliegenden Jahrzehntes deutlich zugenommen. Im Jahr 2015 waren in Deutschland 47 Produkte verzeichnet, die laut Hersteller Nanopartikel enthalten, deutlich mehr als sieben Jahre zuvor. Dabei handelt es sich neben Lebensmitteln vor allem um Nahrungsergänzungsmittel, Küchenartikel wie Schneidbretter oder Frischhaltesdosen, Verpackungen und Agrochemikalien. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, da die meisten Produkte mit synthetischen Nanomaterialien nicht gekennzeichnet oder gemeldet werden müssen. Und selbst bei kennzeichnungspflichtigen Produkten wie Lebensmitteln, Kosmetik und Bioziden führen manche Hersteller enthaltene Nanomaterialien nicht auf der Verpackung auf. So hat der BUND bei Stichproben-Analysen in Cappuccino-Pulver der Firma Jacobs und in Kaugummi von Wrigleys relevante Anteile an Siliziumdioxid beziehungsweise Titanoxid-Nanopartikeln identifiziert, ohne dass diese auf der Liste der Inhaltsstoffe genannt wurden.
Im Dezember 2014 ist eine Kennzeichnungspflicht für Nanolebensmittel in Kraft getreten. Auf Grund einer unzureichenden Definition ermöglicht sie zum Beispiel, dass Lebensmittel mit Nanomaterialien weiterhin ohne Kennzeichnung bleiben. Ein Verstoß müsste offiziell die amtliche Lebensmittelüberwachung feststellen. Sie verfügt aber derzeit noch über keine anwendbare Analytik für einen Nachweis. Umso mehr ist es daher mit Blick auf die Vorsorge notwendig, die vorgeschriebene Kennzeichnung durchzusetzen. Das Vorsorgeprinzip gilt besonders für Anwendungen, bei denen die Gefahren nicht abgeschätzt werden können – wie bei der Nanotechnologie.
Gesetzgeber in der Pflicht
Weil die französische Regierung ein Verbot des Zusatzstoffes noch in der ersten Hälfte des Jahres 2019 angekündigt hat, haben bereits zahlreiche französische Hersteller Titandioxid problemlos aus ihren Produkten verbannt. Auch ernährungsphysiologisch besteht keine Notwendigkeit, synthetische Nanopartikel in Lebensmitteln zu nutzen. In Deutschland muss der Gesetzgeber verpflichtet werden, das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Verpackungen, Küchenartikeln oder Agrochemikalien zu untersagen, die freisetzbare Nanomaterialien enthalten. Der BUND fordert zudem den vollständigen Verzicht des Einsatzes von Nanomaterialien, die Menschen über ihre Nahrung oder die Umwelt ungewollt aufnehmen können. Das sollte so lange gelten, bis wirksame nanospezifische Regelungen in Kraft sind und ausreichende Daten zur Risikobewertung vorliegen, die mögliche Risiken hinreichend ausschließen. Bis dahin muss für Verbraucher durch eine Kennzeichnungspflicht die Wahlfreiheit zwischen Nano-Produkten und nano-freien Produkten gewährleistet sein.
Bild © Maitree Boonkitphuwadon/123RF.com
Stichworte: Nanomaterialien, Nanopartikel, Zusatzstoffe, Titandioxid, Siliziumdioxid, Rieselhilfen, Carotinoide, Farbstoffe, Nahrungsergänzungen, Toxizität, Entzündungen, BUND
 Dieser Beitrag ist erschienen in:
Dieser Beitrag ist erschienen in: UGBforum 2/2019
Erbsen, Bohnen, Linsen – Gutes aus der Hülse
Heft kaufen